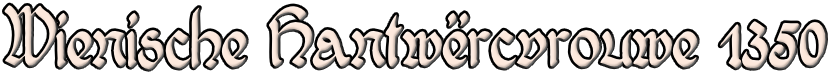Blog
Für die Rekonstruktion einer passenden Bruoch hab ich mich mangels Funden an diversen Abbildungen orientiert. Vom Modell her sind sie alle sehr sehr ähnlich, etwa knie- bis oberschenkellang und oben etwas überweit.
Lombardei um 1365-1370
Interessantes Detail des Bruchengürtels und der Befestigung der Hosen
Buttigliera Alta, Italien um 1410
ein mit Knebel befestigter Beinling und Bruchengürtel Detail
Da ich ja meinen Herzensmenschen schon mit seiner Gruppe in die griechische Antike begleite und wir auch gemeinsam Dinge in der Steinzeit unternehmen, wurde es ja wirklich Zeit, dass er auch hin und wieder mal reinschaun kann, wenn ich mit meinem ältesten Baby, dem 14ten Jahrhundert unterwegs bin.Und ich dachte, ich nehm euch jetzt einfach mal mit auf die Reise, wenn ich eine Komplettausstattung für 1350 für ihn von 0 auf 100 durchgestalte.
Ein weiterer Eintrag in unserer Rubrik Anleitungen, heute machen wir eine Damengugel, wie es sie hier in Österreich ab Mitte des 14. Jhdt gab. Ihr kennt ja vielleicht bereits das Modell von Firiel.
Eine genauere Besprechung zur Gugel findet ihr auf unserer Kopfbedeckungs-Seite. Den frühesten Bild- Nachweis in Österreich kennen wir aus dem Codex 1203 um 1340 in St Pölten. Charakteristisch hier, wie bei vielen Frauengugeln, der kurze, nach vorne geklappte Zipfel und das kontrastfarbige Innenfutter, das über der Stirn umgelegt wird. Um 1350 erwähnt Heinrich der Teichner die Damengugel in einem seiner satirischen Gedichte.
Im Ausland tauchen zB sehr früh in der Maciejowski Bibel und dem Codex Manesse (hier sogar mit einem Gugelhut für Damen) Bildbelege auf. Später häufen sich die Belege vor allem in Frankreich und England zB im Roman de la Rose oder im Lutrellpsalter oder hier um 1320 in den Maastrich Hours.
Hier möchte ich eine Gugel nach den Londonfunden nachkonstruieren, da sie den meisten Bildbelegen nahekommt, die man zur Frauengugel kennt (nicht der flämischen, die ist ja noch mal anders geschnitten, weil offen). Ähnliche Formen finden sich zB auch in den Herjolfsnes-Funden (zB 75, 76 und 77)
Für unser Projekt Farbe habe ich mir endlich einen langgehegten Wunsch erfüllt und ein neues Handwerk erlernt. Dazu morgen hier mehr, aber zuerst musste natürlich das passende Handwerkszeug her.
Vielleicht erinnert ihr euch ja, dass ich euch hier schon einmal gezeigt hatte, wie man einen Damenkittel nach den Herjolfsnesfunden an sich selbst anpasst. Etwas ähnliches möchte ich jetzt für einen Herrenrock nach Art der Mitte des 14. Jhdt in Wien versuchen.
Kürzlich habe ich für einen Herrenrock ein paar Knopflöcher gemacht, da zeige ich doch gleich, wie die versäubert werden.
Manchen ist Claudia Z. ja bereits von IG Mim-Veranstaltungen (z.B. Ronneburg), aber auch z.B. von unserem Juli-Kanzachwochenende ein Begriff. Und besonders erst durch eine besondere Stärke von ihr: Die historische Küche!!
Als Küchenfee hat sie bisher jeden Verköstigten zu Begeisterungsstürmen über ihre Rezepte veranlasst – und sobald bekannt wird, dass sie für die Verpflegung sorgt, kann man die Zeit bis zur VA kaum abwarten!
Einige Rezepte von unserem gemeinsamen Kanzach-Wochenende – aber auch von der Ronneburg-VA, an welcher wir leider schlussendlich aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen konnten – finden sich auf ihrem Blog: https://www.timmermansche.de/
Viel Spaß beim Durchstöbern & Nachkochen!!
Vor kurzem habe ich euch ja einen kleinen Abriss zum Wäsche waschen im Mittelalter gepostet. Nun, auf der Kanzach vergangenes Wochenende, bot sich – in Zusammenarbeit mit Nini – die Möglichkeit, unser geballtes theoretische Wissen auch einmal praktisch auszutesten.
Vorranging haben wir diesmal das Thema Weißwäsche sowie Bleichmethoden erprobt.
Im 14. Jahrhundert in Wien gibt es vermutlich so viele Varianten, Schleier zuzuschneiden, anzustecken und zu tragen, wie es Frauen gibt. Hier geht es um Überlegungen zum Zuschnitt von klassischen Schleiern.
Gerade in den Färberezepten des Spätmittelalters (vgl. auch diese PDF mit einer Sammlung historischer Rezepte für Färberei und Buchmalerei) sticht eine Färbepflanze bzw. Färbe“frucht“ immer wieder z.B. in der Garnfärbung , vermehrt aber als Farbpigment in der Buchmalerei hervor: Die Kreuzdornbeere.