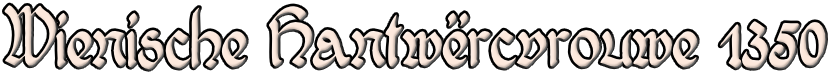Blog
Im Gasometer D findet sich ein besonderer Archivschatz: Das Stadt- und Landesarchiv mit den Quellen ab dem 14. Jh.!
Heute zum Tag der Offenen Tür nutzte ich die Chance um mich in der als „existierend“ zwar bekannte, aber in der in der Handhabung bzw. den vorliegenden Inhalten eher unbekannte Einrichtung ein wenig umzusehen. Begleitet hat mich dabei Clemens, ebenso fanden sich vor Ort einige bekannte Gesichter von Rittersporn ein.
(mehr …)
Mit ausgehendem 13. Jahrhundert häufen sich die erhaltenen Kleiderordnungen, auch Luxusgesetze genannt, im gesamten europäischen Raum. Kaum eine größere Stadt verfügt nicht über mindestens eine Ordnung, welche die Kleidung der Bürger betraf und diese regelte.
Die zugrunde liegenden Gründe waren vielfältiger Natur:
Sandra von den Burgaere Lintze wollte wissen, wie weit Färbepflanzen als billig oder teuer gelten können.
Eine ansich sehr simple Frage, dachte ich mir und machte mich gleich über meine Bücher her… um sie kurz danach frustriert zuzuschlagen… denn für Österreich gibts in den Werken kaum Quellen, die wenigen österreichischen Publikationen zu dem Thema sind leider auch eher ungenau bzw. unkonkret, sprich um dir, liebe Sandra, da eine konkrete regionale Auskunft zu geben, müssen wir einmal in das Thema Anbau in Österreich generell eintauchen… Und das wird etwas dauern, aber ich bleibe dran!
Was ich bisher sagen kann ist folgendes:
Betrachtet man Bilder und Skulpturen des Mittelalters, so bemerkt man oft zeitlich und räumlich starke Unterschiede in der Gestaltung. Doch zu wissen, wie die Hintergründe in der Kunstentwicklung sind, bietet dem Betrachter ein noch differenziertes Bild zur Interpretation der abgebildeten Details.
Doch wie entstand eigentlich die gotische Kunst in Österreich?
Wann wurde eigentlich das Stricken erfunden?
Glaubt man diversen Museen, so konnten bereits die antiken Menschen stricken! Wer jedoch Nadelbinden kann und den koptischen Stich kennt, schüttelt dabei sehr rasch den Kopf. Und auch neuere Untersuchungen an Textilien aus der Zeit , welche bisher als „gestrickt“ galten, werden bei genauerem Hinsehen als Nadelgebunden erkannt. (mehr …)
Redet man von Schachteln als historischer Begriff spricht man in der Regel von Spanschachteln.
Eine Spanschachtel – wobei diese Bezeichnung erst recht spät aufgekommen ist – besteht aus vier Teilen: Der Deckel, einem Boden und zwei Seitenteilen, den sogenannten Zargen bzw. im österreichischen auch Reif. Die Zargen werden genäht/gebunden/geheftet. (mehr …)
So da Niko gerade in Schreiblaune ist, steckt das an!
Teil I (Erste Einführung & Gedanken) & Teil II (Grundaustattung Mann/Frau) zum Einsteigerleitfaden fürs 14. Jh. findet ihr auf seinem Blog
Niko hat schon beschrieben, was Mann/Frau so im Grunde trug, doch wenn es um die Umsetzung geht, stellt sich natürlich auch die Frage nach den Farben der Kleidung bzw. dahingehend auch nach etwaigen Symbolen zur Kennzeichnung gewisser sozialer Randgruppen. (mehr …)
Rechts vom Riesentor am Stephansdom in der Wiener Innenstadt befinden sich seit etwa 1450 zwei längliche Metallstäbe. Hierbei handelt es sich um die ältesten, erhaltenen Maßstäbe Österreichs und sie repräsentieren als Kontrollmöglichkeit für Händler und Käufer die sogenannte Wiener Tuch- bzw. Leinenelle.
Der kürzere Stab, die Wiener Tuchelle, misst 776 mm, der längere, die sog. „Leinenelle“ 896 mm.
Die bis heute leider bisweilen bei Wien-Führungen und Volkschullehrern immer noch beliebte Deutung des darüber liegenden runden Steinkreis als Maß für einen Brotlaib ist nichts anderes als ein moderner, romantischer Mythos. In der Vergangenheit zierte das Portal des Riesentors ein Rokoko-Gitter, welche bis zur Ersetzung durch ein sich nach innen hin öffnendes Gitter in Gebrauch war. Durch das häufige Öffnen und Schließen des Rokoko-Gitters hat sich im Laufe der Zeit diese Kreismarkierung im Bereich der Befestigung eingeritzt.
Ein großer Einflussfaktor auf den mittelalterlichen Alltag, den viele Menschen klar unterschätzen, ist die Religion.
In einer Welt, in der man ständig vom Tod abgeholt werden kann, da gewinnt das Leben nach selbigem natürlich eine große Bedeutung. Und die Art, wie man sein Leben verbringt, bestimmt maßgeblich die Art, wie man das ewige Leben verbringen darf.
Neben einem möglichst guten und aufrechten Leben, ist das tägliche Gebet ein Weg, wie mans ins Himmelreich schaffen kann.
Am Mittwoch erpackte ich endlich die Gelegenheit beim Schopf und huschte einen Sprung in die Dependenz des Wien Museums um in den Tuchlauben 19 im Wiener 1. Bezirk die Neidhartfresken zu bewundern.
Die Wandmalereien stammen aus den Jahren um 1400 und befinden sich in einem ehemaligen Tuchhändlerhaus. Belegbar ist das Haus Nummer 19 erstmals um 1370, damals noch im Besitz des vermögenden Juden David Steuß (gest. um 1386/87). (mehr …)